„Tanz. Fabrik!“ nennt das Theater Regensburg jenes Format, unter dem die Tänzerinnen und Tänzer des Ensembles einmal in der Spielzeit eigene Stücke kreieren und präsentieren dürfen.
„Tanz. Fabrik!“ nennt das Theater Regensburg jenes Format, unter dem die Tänzerinnen und Tänzer des Ensembles einmal in der Spielzeit eigene Stücke kreieren und präsentieren dürfen. Yuki Mori, der künstlerische Leiter, tat gut daran, den Abend mit einem Thema anzuleiten. Als internationale Compagnie, deren Mitglieder zum Teil lange im Flieger sitzen müssen, um die Familie zu besuchen, lag das Thema „Heimat“ auf der Hand. In diesem Zusammenhang machte Ljuba Avvakumova am eindrücklichsten auf sich aufmerksam. „Drückende Weiten“ nennt die junge Russin ihre Choreografie. Tanzen lässt sie einen Mann, Shota Inoue, und sich selbst unter einer langen, roten Bahn aus Tuch die Spannungsverhältnisse, denen das Individuum in Russland ausgesetzt ist. Wie klein und ferngesteuert – sie klemmt den Ellbogen in seine Hüfte – stehen sie zunächst beisammen, den Blick nach oben gerichtet, bewegen sich fahrig, abrupt im Gleichschritt vor einer Macht, die hier kein Gesicht hat. Bewegend: ihre ersten kleinen Gesten, nur zwei Sekunden lang, und auch wenn sie dieses Moment großer Ehrlichkeit nicht durchhält, sondern immer wieder ins Darstellerische kippt, ist die hohe Qualität gesetzt. Der Tanz, das unsichtbare Wesen, war da. In prägnanten Szenen blitzen anschließend eindrucksvoll Momentaufnahmen auf, deren Realitätsnähe berührt: der wild zu Volksliedern tanzende und danach müde herumliegende Mann; die nicht beachtete, innerlich nur schier überlebende Frau. Das System hält sie irgendwie zusammen, tot ist viel nach innen und ebenso groß die Sehnsucht nach Leichtigkeit, Befreiung. Ein aktuelles Stück Tanz, von dem man noch mehr will.
Poetischer und leiser danach Pauline Torzuolis Kreation „Adossé“, was soviel wie „sich anlehnen“ heißt. Drei Schaukelstühle, zwei Frauen und ein Mann beherrschen die Szenerie, die einen unmittelbar in die sinnliche Dunkelheit einer „Der Liebhaber“-Verfilmung von Marguerite Duras versetzt. Irgendwie setzt man sich eine Dreiecksgeschichte zusammen, Erinnerungen an Menschen, die nicht mehr da sind, aber auf den Stühlen gesessen, gelebt, gefühlt haben. Am Ende aber fehlte hier der Zug, klar mit der schwierigen Kategorie der Zeit im Tanz umzugehen.
Alessio Burani setzte hier deutlichere Zeichen: Er ließ Ljuba Avvakumova in seiner Kreation „Centolire“ zunächst auf der Bühne eine Geschichte vom Bruder erzählen, um sie nach und nach in einen Pas de trois mit zwei anderen Tänzerinnen gleiten zu lassen. Ein spannendes, weil selbstreflexives Moment großer Ehrlichkeit gestaltete sich als eine alte Farbfotografie mit drei halbnackten badenden Mädchen die Bühne einnahm und zum Tanz in Bezug gesetzt werden konnte. Ein unerwarteter Verweis auf die Reichweite dessen, wo sich Tanz ereignet – manchmal weit weg von der fast kitschig und damit austauschbar wirkenden Bewegungskreation. Einen starken Kontrast setzte Tulant Shehu. Schneeflocken rieseln heraub auf den Tänzer der allein gelassen im Raum steht. Authentisch vermittelt „… te dhasht“ Gefühle der Beklemmung, der inneren Kälte, des Überlebenmüssens. Mit ihm drei Mittänzer, die in kraftvollen Variationen den Raum immer wieder neu definieren, überflüssigerweise ergänzt um eine Gruppe von vier Tänzerinnen, da sie das Thema der Heimatlosigkeit kaum mehr als bebildern. Im zweiten Teil des Abends wartete Yuki Mori mit einer risikoreichen Überraschung auf: Eingeladen hatte er Leonard Eto, einen Taiko-Spieler, der in volkstümlichem Gewand kunstvoll die traditionellen Trommeln Japans beschlug. Tanz hat es daneben schwer. Mori wagte es trotzdem und platzierte sich und Harumi Takeuchi in brauner Wollhose und blauem Pulli in schlichtesten Bewegungen neben den instrumentalen Aufbau – eine Rechnung, die aufging. Eine grafische Zeichnung aus Gesten, Linien und eruptiven Ausbrüchen, beherrscht vorgetragen, wenn auch inhaltsleer. Spannend was sich danach ereignete: zwei Gruppenchoreografien, in rauchiges Zwielicht getaucht, nahmen es mit der Percussion auf. Vorallem „Rootless“ von Andrea Vallescar und Claudio Costantino überzeugte. Es wirkte urban, stark, zeitgemäß und dennoch verwundbar – in den Bewegungsmustern ganz im State of the art: viel synchrone Gruppenführung, kurzteilige Bewegungen, kraftvolle überraschende Wendungen. Warum all das nicht ausreichte, damit das Publikum hier genau so laut und anhaltend applaudierte wie in dem Moment, als sich Eto mit einer Solonummer präsentierte, sinniert man auf dem Nachhauseweg.
Erschienen am 27.5.2014 bei http://www.accesstodance.de/blog/26428/tanz-die-heimat
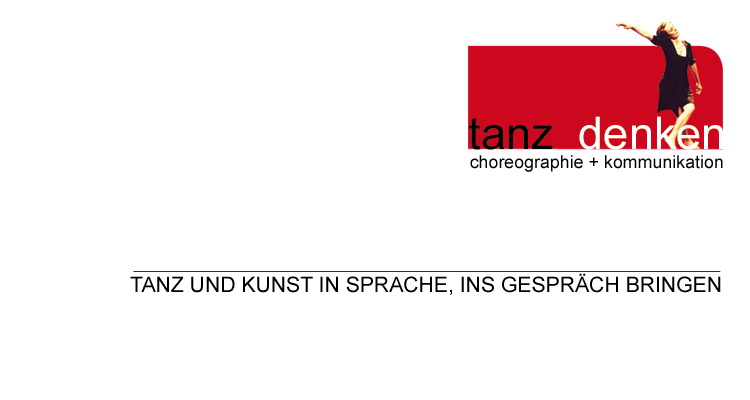

Neueste Kommentare