In Zürich interpretiert Christian Spuck den Ballettklassiker „Nussknacker und Mäusekönig“ als üppiges Illusionstheater mit Ironie
Derjenige, der es geschafft hat, einen quasi in die Knie zu zwingen, zurück auf Einmeterzwanzig-Größe, ist Christian Spuck, seit fünf Jahren Chef des Ballett Zürich. Seine Interpretation der berühmten Erzählung „Nussknacker und Mäusekönig“ von E.T.A. Hoffmann aus dem Jahr 1816 ist Illusionstheater pur – aber mit Stil. Geschult an der apolitischen Inszenierungsweise von Erzählballetten von John Cranko, steckt seine Freude an, den ständigen Wechsel und die Überlagerungen von dem, was Phantasie und was Wirklichkeit, was Spiel und Realität, Spiel im Spiel und Traum und Wachzustand ist, kritiklos zu genießen. Es bleibt einem ja auch nichts anderes übri. Bei so viel Taft und Tüll und einem bei mitternächtlichem Ding Dong groß über die Bühne wehenden Uhrenpendel. Und so wirkt, spätestens ab dem zweiten Teil, Spucks „Nussknacker und Mäusekönig“ in der exquisiten Edelausstattung der israelischen Kostümbildnerin Buki Shiff wie eine Fahrt im Kettenkarrussel hoch in der Luft. Kreischend zeigt man mit dem Finger nach unten, weil man etwas Schönes oder Lustiges entdeckt hat – in dem Fall: Mäuse mit Schwänzen, ein stilechter Nussknacker, eine Königin, Stepptanz, als Seerosen verkleidete, Ballett tanzende Revuegirls, halbstarke Männer mit Blumenbärten und einen schönen Beau, der Marie küsst. Ganz echt. Endlich einmal. Und dabei trägt er so einen schönen Pullunder mit Rauten.
Nach dem Motto „Ist doch egal wie die Welt da draußen ist, ich machs´ mal mit Ironie und Eleganz“ hat der frühere Hauschoreograph des Stuttgarter Balletts gemeinsam mit seinen Dramaturgen Michael Küster und Claus Spahn den Ballettklassiker mit einer großen Portion Unbekümmertheit und Abgewandtheit von den Krisen dieser Welt oder anderen Inhalten durch seinen Spuckschen Wolf gedreht. Es dominiert der Spaß am ironischen Spiel mit der klassischen Aufführungstradition des „Nussknackers“ seit dessen Uraufführung in St. Petersburg im Jahr 1982. Am spannendsten ist sein Umgang mit der Originalpartitur von Peter I. Tschaikowsky. So stellte er die Reihenfolge der einzelnen Tänze der Komposition um und verband bestimmte Nummern, sensibel auf die Musik eingehend, mit anderen Tänzen als in der Originalfassung vorgesehen. Dies beschert nicht nur ein neues, wunderbares Hörerlebnis der berühmten Melodien. Auch der Aufführung wird so ein passendes, Filmlänge entsprechendes Timing, Tempo und dramatischeres Gesicht verliehen. Auch Spucks Bewegungssprache bildet sich, von Blockbuster zu Blockbuster, den der sympathische Künstler produziert, feiner heraus. Seine zeitlos neoklassisch grundierte Gestaltung des Körpers ist zuverlässig angereichert mit den wiedererkennbaren Elementen aus dem Zeitgenössischen, wie etwa dem Überschlagen der Unterarme, immer wieder die Betonung des Rückens oder die tiefe zweite Position.
Wunderbar ist, dass er die komplizierte Ursprungserzählung, die oft beiseite gelassen wird, mit auf die Bühne gebracht hat: Das Märchen von der harten Nuss. Es erklärt die Bedeutung des Nussknackers. So erzählt Spuck einerseits Geschichte von Marie, die an Heiligabend von ihrem Onkel Drosselmeier einen Nussknacker geschenkt bekommt. Dieser wird nachts im Traum lebendig und kämpft gegen eine Rotte wild gewordener Mäuse an. Danach verwandelt er sich in einen Prinzen, der sie ins Zuckerland entführt. Im wahren Leben entpuppt er sich als Neffe des Onkels, in den sie sich, eine junge Frau geworden, verliebt. Davor wird, als Spiel im Spiel, gezeigt, wie die schöne Prinzessin Pirlipat in ein Nussmonster verwandelt wird, weil deren Mutter eine Maus getötet hat. Erst ein schöner Prinz erlöst sie, wofür er aber mit einer Verwandlung in einen Nussknacker bezahlen muss. Spuck erzählt dabei verschachtelt, mal zur einen, mal zur anderen Erzählung flanierend. Michelle Williams als Marie, Giulia Tonelli als Pirlipat, William Moore als Nussknacker oder Dominik Slavkovsky als Drosselmeier spielen dabei ihre Rollen mit Bravour und Schönheit aus, so wie das gesamte Ensemble keck und sprudelnd vor Freude die Bühne beherrscht. Und dennoch ist man am Schluss froh, in die Gegenwart entlassen zu werden. Süßes stillt nicht den Hunger. Nur das wahre Leben.
Erschienen im SÜDKURIER am 16.10.2017
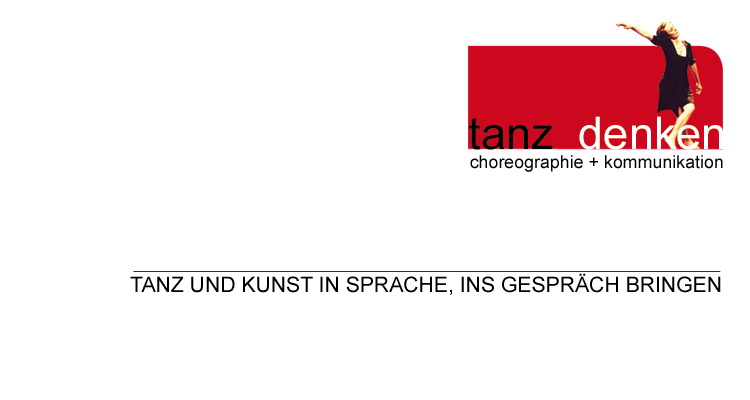




Neueste Kommentare