Mit Werken der drei Choreografen Edward Clug, Jirí Kylián und Louis Stiens zeigt das Stuttgarter Ballett wie viel man alleine durch Bewegung erzählen kann.

Ssss…
Ch. Edward Clug
Tänzer/dancers: Rocio Aleman, David Moore, Pablo von Sternenfels
©Stuttgarter Ballett
Das Wiedersehen mit dem bestechenden Stück bei einer der besten Kompanien Europas, das erste von Dreien an diesem Abend, eröffnete neue Perspektiven. Es inszeniert sich als Kontakthof der zufälligen Aufenthalte und Begegnungen jener Menschen, die in der Parallelwelt globalisierter Wirtschaft unterwegs sind. Powerpärchen, nach außen hin straff und glatt organisiert, jedoch heillos in ihre problematischen Machtkämpfe und Beziehungsmuster verstrickt, befangen im Selbstoptimierungszwang, sodass Liebe längst keinen Platz mehr hat, auch wenn deren verletzende Kraft noch da sein darf. Der Ort, an dem diese Menschen miteinander ihre Geschichten klären, könnte konkret ein leerer Konzertsaal sein, in dem die Pianistin Alina Godunov mehrere „Nocturne“ von Chopin spielt, mit dem Rücken zum Publikum. Es könnte auch eine Lobby in einem Hotel oder am Flughafen sein. Ein Haufen Stuhlreihen drängelt sich auf der Bühne. Die Filme „Lost in Translation“ oder „Somewhere“ von Sophia Copola fallen einem ein, oder die Gemälde des amerikanischen Malers Edward Hopper. Dort jedenfalls werden die spannungsreichen Duette und Trios zu Spiegelbildern kontrolliert ausgetragener Fehden, eingebettet in eine Grundatmosphäre trennender Einsamkeit und kaum formulierter Sehnsucht nach Ausstieg. So könnte man „Ssss …“ in seinen Tiefenschichten salopp interpretieren. Denn nie fließt ihre Bewegung nach außen, immer stoppt sie vor ihrer Entfaltung, wendet sich zurück zum Körper, der sich faltend und verschiebend durch den Raum in die nächste Begegnung hineinmanövriert. Der Rhythmus der Bewegungsskulpturen, die aus einem Lebensreich der Strukturierung, der Anpassung und der Zielorientiertheit zu kommen scheinen, ist schneller als Chopins Musik, die alles umspült; unregelmäßiger, sehr zeitgemäß, in gepresster, markiger Hetze, fast zuweilen puppenhaft. Am Ende war man auf der Hut gewesen gegenüber Chopins „Nocturne“-Kompositionen, die gleichwohl bereits zur Zeit ihrer Entstehung das gesamte Spektrum menschlicher Empfindungen zum Thema machten, Zeuge einer handfesten Dreiecksgeschichte, Frauenfiguren, die gehen oder verlassen werden, und Männern, die kaum Beziehung zu gestalten vermögen.
Ähnlich weit kann auch Louis Stiens choreografische Kunst den Betrachter tragen, auch wenn seine Uraufführung am Anfang schwieriger zu greifen war, sprich: erst einmal stumm blieb, um dann aber mit einem klaren Statement zu enden. „Qi“ markiert einen spannenden Versuch eines noch jungen Choreografen, einen eigenen Entwurf zeitgenössischen Balletts anzupeilen, der, ähnlich wie dies bei den früheren Goecke-Stücken schon der Fall war, schier berstende Energie des Lebens und Lust am Tanz in eine individuelle ästhetische Handschrift zu überführen sucht, die gleichzeitig aktuelles Lebensgefühl zum Ausdruck bringt. „Qi“ auf Kompositionen des Barock-Komponisten Johann Heinrich Schmelzer, beginnt mit einem Solo von Hyo-Jung Kang, begrüßt dann eine Gruppe junger männlicher Tänzer, um danach zu seinem ersten Höhepunkt zu gelangen: ein langes Solo getanzt von Adam Russel-Jones, dessen Bewegung der Handflächen und der Füße immer wieder an den von Nijinsky überlieferten Bewegungstext erinnerte. Ein sprühender, auch schräger, humorvoller Geist, der eine wunderbare Begegnung mit seiner Partnerin feiert – es schien, als ob hier eine Blaupause für eine nächste Interpretation von „L’après midi d’un faune“ abgegeben würde. Während das Stück also kurzweilig zwischen Soli und Gruppenparts hin- und herkreiselte und -wedelte, mit diskreten, aber für Abwechslung sorgenden Kostümwechseln, gewann es an Bedeutungsdichte. Bald ahnte man, dass hier jemand über die Nutzung verschiedener Bewegungsbilder Tanz hinsichtlich dessen Geschichte punktuell und ausschnitthaft bis zur Gegenwart erzählen mag – vom Gruppentanz des Barock über den Beginn der Moderne bis zur elektronisch zugemüllten Gegenwart. Wie wenig Platz und Chancen die heutigen Beats einem plötzlich filigran wirkenden Tänzer lassen, wie sehr er dagegen ankämpfen muss, zeigt die Schlussszene mit einem faszinierenden, den Blick verschwimmen lassenden Videobild von Christine Nasz: Stiens lässt Robert Robinson zu Evian Christs „That´s me“ arbeiten, bis er wie ein fauler Matschklumpen gegen die hintere Bühnenwand klatscht. Hier wird „Qi“ zum kritischen Statement gegenüber einer alle Bewegung und Körper dominierenden Industrie.
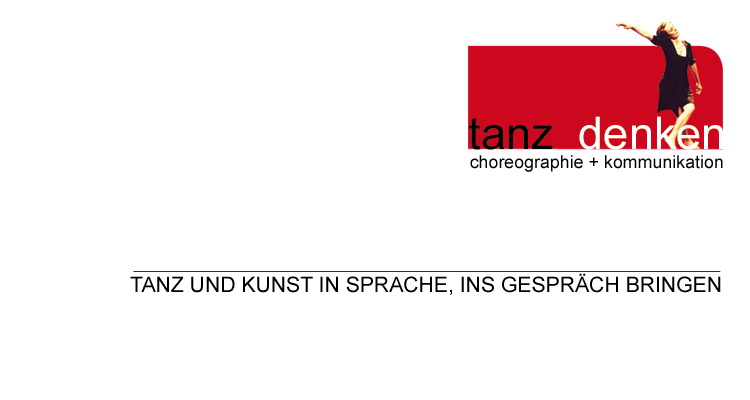





Neueste Kommentare